Hier zeige ich dir eine Auswahl meiner Texte; die immer auch zu einer Illustration gehören.

Du bist nie zu viel.
Nie zu intensiv.
Nie zu emotional.
Nie zu bedürftig.
Nie zu kompliziert.
Nie zu liebevoll.
Nie zu laut.
Nie zu viel.
Und wer dir etwas anderes sagt, meint vielleicht eigentlich,
dass nicht du zu viel bist, sondern andereszu wenig:
Zu wenig Ressourcen vielleicht; zu wenig Empathie, zu wenig
Raum. Zu wenig Wissen, Anerkennung oder Hilfe.
Das ist nicht deine Schuld. Und du musst nicht allen
gefallen.
Du
bist nie
zu viel.

Diese Postkarte mit Text ist Teil von meiner Kunstbox "Löwenzahnmut". Du findest sie bei mir im Shop.
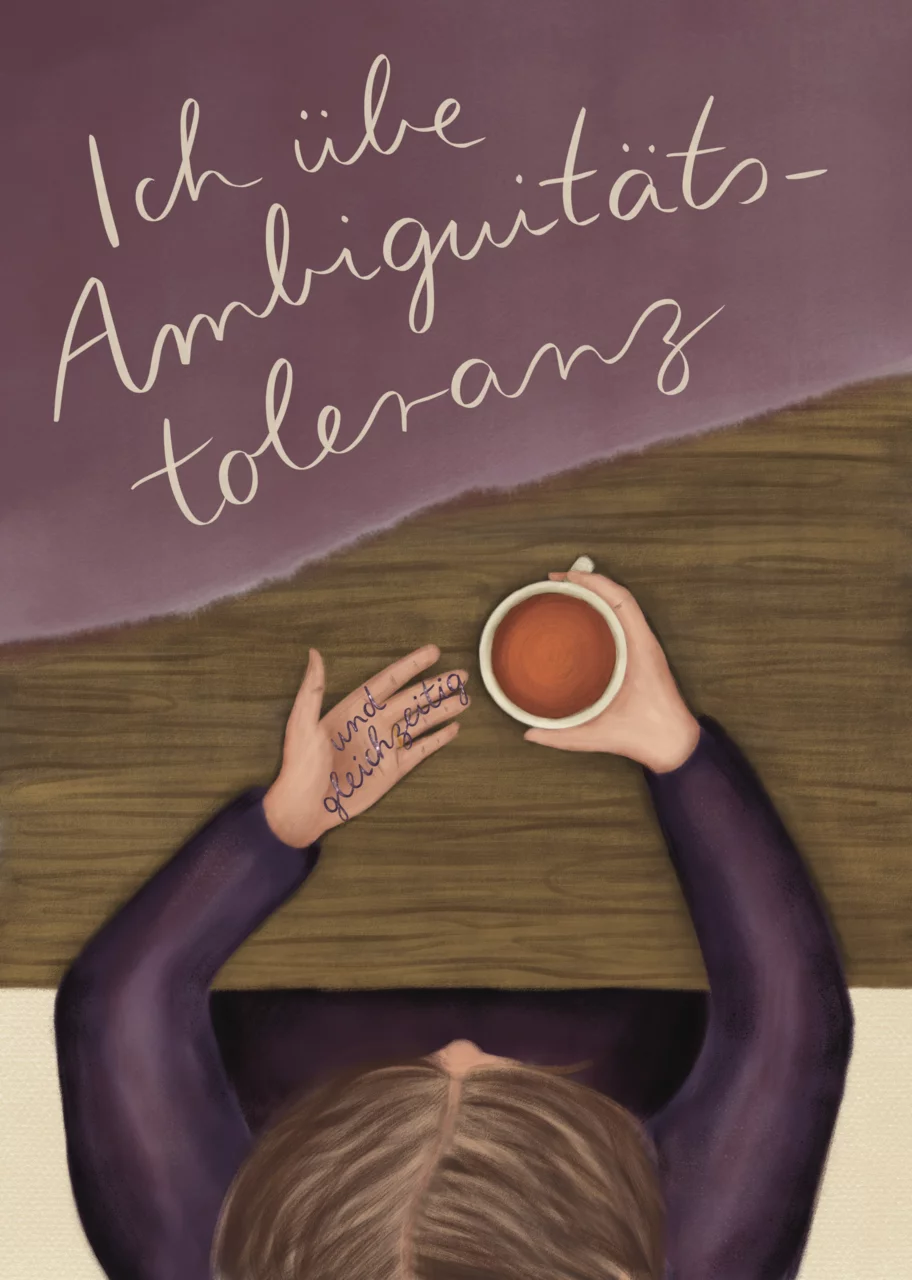
Die Ambiguitätstoleranz sitzt mit mir am Küchentisch, zieht meine Teetasse zu sich herüber und blickt mich stumm an. Ich hatte sie nicht eingeladen.
„Was machst du hier?“, brumme ich und beginne, die Spülmaschine auszuräumen.
„Ich hab gesehen, dass es nicht einfach war für dich in der letzten Zeit“, sagt sie leise.
„Was war nicht einfach?“ Ich runzle die Stirn.
„Naja“, die Ambiguitätstoleranz nimmt einen Schluck von meinem Tee, „du hast gemerkt, dass das Leben ziemlich komplex ist, oder? Und dass es manchmal keine einfachen Antworten gibt. Du hast Gegensätze aushalten müssen. Sich widersprechende Bedürfnisse und Perspektiven. Du hast manche deiner Prinzipien neu gedacht.“
Ich muss schlucken. „Aber“, entgegne ich, „aber das ändert sich doch wieder, oder? Es wird doch wieder so einfach, wie es mal war?“
Die Ambiguitätstoleranz schüttelt den Kopf. „Nein.“ Sie macht eine Pause. „Nein, das wird es nicht. Das Leben ist zu komplex für einfache Antworten. Und deswegen bin ich zu dir gekommen. Ich hab dir nämlich was mitgebracht.“ Sie kramt in ihrer Hosentasche zwei kleine Worte hervor und reicht sie mir. „Ein und gleichzeitig.“
Ich blicke sie irritiert an. „Ein und gleichzeitig?“
Sie lächelt. „Ja. Denn Ambiguitätstoleranz gibt dir ein und gleichzeitig, wo zuvor ein aber war. Sie schenkt dir ein ‚sowohl als auch‘, wo du zuvor nur ein ‚entweder - oder‘ hattest.“
„Das klingt sehr anstrengend“, sage ich.
„Ja, zuerst schon. Und unperfekt, ich weiß. Aber Ambiguitätstoleranz kann auch so frei machen. Sie schafft Graustufen und Regenbögen. Sie ermöglicht Frieden, ohne es sich zu einfach zu machen.“
Ich spüre das und gleichzeitig in meiner Hand. Es fühlt sich gut an.
Diesen Text findest du unter anderem als Postkarte in meinem Shop. Rund um das Thema Gleichzeitigkeit habe ich ein ganzes Buch geschrieben: „und gleichzeitig… Eine Liebeserklärung an zwei Worte, die das ganze Leben umspannen."
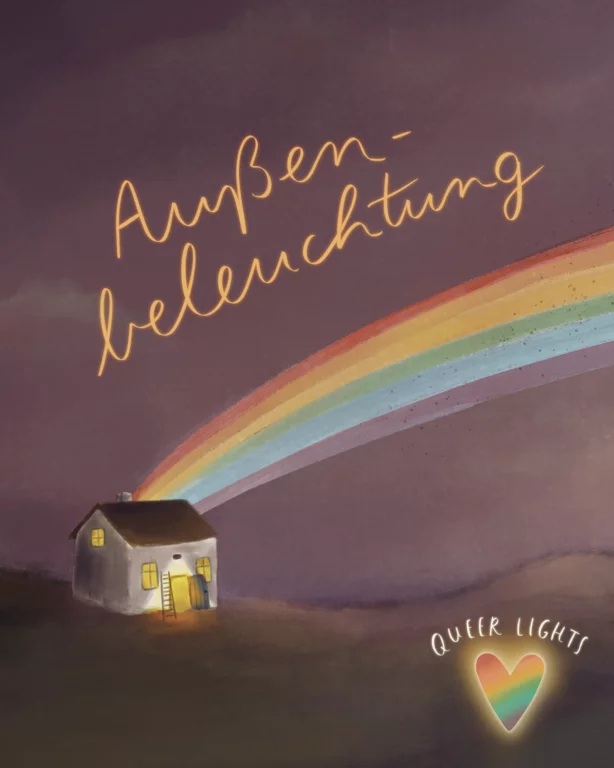
Ein Text aus meiner „Queer Lights“-Reihe.

Hoffnung gibt mir das Unbequeme.
Wenn wir uns füreinander einsetzen; auch, wenn es uns
anstrengt.
Wenn wir hinter unseren Werten stehen; auch, wenn es uns nicht
beliebt macht.
Wenn wir einander zuhören; auch, wo es ungemütlich ist.
Wenn wir solidarisch sind mit denen, die es brauchen; auch,
wenn es uns etwas kostet.
Wenn wir Konflikte bereinigen, auch dann, wenn es anstrengend
ist.
Wenn wir Farbe bekennen; auch dort, wo die Dinge in Brauntönen
gefärbt sind.
Wenn wir uns hinterfragen (lassen); auch dann, wenn es am
Weltbild rüttelt.
Wenn wir Grenzen respektieren; auch da, wo wir sie gern
überschreiten würden.
Wenn wir Schmerz miteinander aushalten; auch, wenn es
wehtut.
Wenn wir Müll aufsammeln; auch, wenn wir stattdessen Blumen
pflücken könnten.
Hoffnung gibt mir das Unbequeme.
Und wenn wir alle miteinander unbequem sind, können wir es uns
gut machen.

Dieser Text stammt aus meinem Buch "Hoffnung, die leuchtet". Du findest es bei mir im Shop.

Eine kleine Frage war es, die sich im vergangenen Jahr immer wieder leise flüsternd in meinen Kopf schlich.
„Was bringt es denn?“
Leise schlich sie sich in meinen Kopf, als ich während der Einschlafbegleitung der Kinder die Nachrichten las. „Was bringt es denn“, flüsterte die Frage, „Kinder friedvoll in eine Welt zu begleiten, die ganz und gar nicht friedvoll ist?“
Leise schlich sie sich in meinen Kopf, als ich um die Nachhaltigkeit meiner nie-gut-genugen Konsumentscheidungen rang. „Was bringt es denn“, flüsterte die Frage, „wenn du ringst, während letztlich dein Handeln ganz und gar irrelevant ist, weil es vor allem ein Umdenken von Konzernen und Gesetzen braucht?“
Leise schlich sie sich in meinen Kopf, als ich investierte in Inklusion, Gerechtigkeit und Verständigung. „Was bringt es denn“, flüsterte die Frage, „dich da so verletzlich zu machen und zu investieren, wenn am Ende doch wieder die Vorurteile stärker sind?“
Und so schlich die Frage und flüsterte und ach - übel nehmen
kann ich es ihr nicht.
Manche Fragen lösen sich nicht, wenn wir versuchen, sie aus
unserem Kopf zu scheuchen. Manche Fragen brauchen eine Antwort.
Und eine Illustration, vielleicht.
Deswegen hab ich ihr ein Bild gemalt, meiner kleinen großen
Frage: Es ist mein Jahresmotiv 2024; so wichtig ist es mir.
Liebe kleine Frage, schau her.
„Gutes säen“, so heißt mein Bild.
Und du kannst darin lesen, was du lesen möchtest.
Vielleicht siehst du eine kleine Pflanze, die nur allzu bald
von einem herannahenden Lastwagen überrollt werden wird.
Aber vielleicht: vielleicht siehst du auch etwas ganz
Anderes.
Und ganz unverbindlich lass ich dir eine kleine Gießkanne da.
Wer weiß, vielleicht kannst du sie ja mal brauchen.
"Gutes säen" ist mein Jahresmotiv 2024. Du findest es bei mir im Shop.
Unendlich lieben und gleichzeitig Pausen brauchen.
Sich sehr beschenkt fühlen und gleichzeitig hier und dort mit einem Alltag „anders als gedacht“ hadern.
Verständnis für überlastete Lehrkräfte haben und gleichzeitig Inklusion fordern.
Keine verbale Kommunikation benötigen, um dem Kind nah zu sein, und gleichzeitig bei jedem neuen Wort eine Party feiern wollen.
Anstrengung tragen und sich gleichzeitig wünschen, es wäre weniger anstrengend.
Wissen, dass Außenstehende es manchmal nicht besser wissen und gleichzeitig wütend über unbedachte Äußerungen sein.
Müde sein und gleichzeitig nicht abgeben können.
Kein Homeschooling machen wollen und es gleichzeitig als einzige Möglichkeit wahrnehmen.
Die Wohnung voller Gegenstände passend zum Spezialinteresse des Kindes haben und gleichzeitig nicht aufhören wollen, welche zu kaufen, weil es sich dann so freut.
Den*die Partner*in anraunzen und sich gleichzeitig bewusst sein, dass wir ein großartiges Team sind.
Bedürfnisse des autistischen Kindes wahrnehmen und gleichzeitig auch um die aller anderen Familienmitglieder wissen.
Im Frieden sein mit dem, was ist, und gleichzeitig manchmal trauern um das, was nicht ist.
Elternschaft ist voller Gleichzeitigkeit.
Elternschaft mit einem autistischen Kind ist es noch mehr.
Ihr macht es gut.
Wir machen es gut.
Und unsere Kinder sind so toll.
Liebe zu euch!

Die Illustration stammt aus meinem und Anna Mendels Buch „Momo ist das alles viel zu viel“. Du findest es bei mir im Shop.

"Es ist ein Irrtum, zu denken, dass Resilienz alles bewältigen kann. Oder dass wir nur daran glauben müssten, alles schaffen zu können, damit es Wirklichkeit wird.
(…) Wir müssen nicht einfach an unserem *Mindset* arbeiten, nicht einfach ein bisschen Reframing betreiben, nicht einfach ein bisschen Rohkakao zur richtigen Zyklusphase im Mondschein trinken, damit alles ganz einfach ist.
Die Wahrheit ist: Wie viel Ambiguitätstoleranz du brauchst, wie viel Resilienz du benötigst, hat sehr viel mit deinen Privilegien zu tun. Manche Menschen benötigen letztlich sehr viel weniger „und gleichzeitig“ als andere und das ist nicht ihr Verdienst. (…)
In den letzten Jahren ist die spirituelle Blase insbesondere auf Social Media stark gewachsen. Selbsternannte spiritual Coaches verdienen ihr Geld damit, Menschen zu erzählen, sie könnten ja *alles* erreichen; jeder Mensch habe täglich 100 Energietaler zur Verfügung und könne selbst entscheiden, was er damit tut. Tatsächlich aber sind diese Energietaler nur für ziemlich privilegierte Menschen von individuellen Faktoren wie Mindsetarbeit abhängig – für die meisten Menschen sind sie es nicht. Denn Faktoren wie Armut, Krankheit, Behinderung, Neurodivergenz, Diskriminierung, pflegende Elternschaft oder viele andere Dinge reduzieren unsere Energietaler – oder, um in der Spoon Theory zu bleiben, die Energielöffel, massiv. Und zu sagen, das wäre anders, ist nicht nur toxisch und gefährlich, sondern verschiebt das Problem weg von systemischer und struktureller Ebene hin zu „selbst schuld, wenn deine Energietaler nicht reichen“.
„Toxic Positivity“ nennen wir diese Narrative von „du musst einfach positiv denken“, „fokussiere dich auf das, wofür du dankbar sein kannst“ oder „komm aus deiner Opferrolle raus und hör auf, zu jammern“.
Das perfide ist, dass diesen Sätzen natürlich in gewisser Weise ein wahrer Kern innewohnt. Denn ja: Optimismus ist ein Resilienzfaktor, Dankbarkeit etwas Gutes und es kann viel Kraft freisetzen, aus einer passiven in eine aktive Rolle zu kommen. Aber Missstände zu leugnen und Lösungen auf individueller Mindsetebene zu propagieren, ist Gaslighting in höchster Form. Selbstoptimierung hat ihre Grenzen. Und wir müssen das anerkennen."
Dieser Text ist ein Ausschnitt aus meinem Buch "und gleichzeitig...", das du hier findest.
„Er liebt Delfine.“
______________
Regelmäßig bekomme ich Anfragen, ob ich das ein oder andere
meiner Motive nicht auch noch passender für Jungen oder
passender für Mädchen illustrieren könne.
Und - nein, das kann ich nicht. Und nicht nur deswegen nicht,
weil ich immer noch nicht herausgefunden habe, ob ein Delfin
nun ein Jungen- oder Mädchentier ist.
Meine Kunst denkt nicht in binären Kategorien, sondern soll
Identifikationsangebote für ALLE Kinder schaffen.
Und wenn ihr mich um eine Empfehlung aus meinem Shop für euer
Kind bitten würdet, würde ich nicht nach Junge oder Mädchen
fragen, sondern nach seinen Interessen und Themen; nach dem,
was es beschäftigt und welche Bedürfnisse es hat; nach dem, was
es lustig oder schön findet.
Und na klar: Delfine gibts auch. Die hat Miniflause gemalt -
ziemlich fernab von Mädchen - und Jungstieren. 💜
Dieser Text ist ein Ausschnitt aus meinem Buch "Und gleichzeitig...", das du hier findest.



Die Illustration stammt aus meinen „Baumbotschaften“.

Ich saß bei ihr in der Küche und war sehr wütend.
„Ihr habt euch doch so lieb“, sagte sie und stellte die
Reibekuchen auf den Tisch. „Was könnt ihr tun, um wieder gut
miteinander zu sein?“
Ich rief sie von der Schule aus an und fragte, ob sie mich
wegen Bauchweh abholen könnte.
„Du hast gar kein Bauchweh, stimmt’s?“, sagte sie, als ich bei
ihr im Auto saß. „Du musst das nicht erfinden, damit ich dich
abhole. Es ist doch ok, einfach mal so eine Pause zu brauchen.”
Ich verlor den Haustürschlüssel und erwarte, dass sie schimpfen
würde.
„Sowas passiert einfach“, sagte sie und nahm mich in den Arm.
„Wir finden eine Lösung.“
Ich heiratete und es war ganz anders, als sie es für sich
selbst entschieden hätte.
„Das wird schön“, sagte sie, „ich bin für dich da.“ Sie wurde
meine Trauzeugin.
Ich kaufte mir ein Buch, um Erinnerungen und Gespräche mit ihr
festzuhalten.
„Was wünschst du dir für die Welt, Oma?“ fragte ich sie, als
wir auf Seite 29 waren. Dort hab ich ihre Antwort
aufgeschrieben: „Dass alle Menschen in ihrem Leben so viel
Verständnis, Vergebung, Hilfe und Liebe erfahren, dass keiner
mehr einen Krieg anfängt. Mein Herz schmerzt beim Gedanken,
dass das nur ein Wunsch bleiben wird.“
2017 ist sie gestorben. An Tagen wie heute wünschte ich, sie wäre unsterblich und könnte die Geschicke dieser Welt lenken. Liebe und Reibekuchen.
My biggest Hope
is that one day
my Kids look back on their childhood
and know that their mom
didn‘t just love them.
She
truly
enjoyed
them.
Diese Sätze sprangen mir heute Morgen entgegen, als ich
Instagram öffnete.
Ein Reel-Trendsound.
Ich musste schlucken.
Next Level Mutterschaft also: die Kinder nicht NUR lieben,
sondern sie wahrhaft zu genießen. Und zwar so intensiv, dass
sie sich dessen später im Rückblick auf ihre Kindheit gewiss
sind. Ist das meine biggest hope?
Toxische Mutterideale at it‘s best: dieser Reel-Trend wird
unterlegt mit Videos von Kindern, deren perfekt drapiertes
Abendessen auf einer Duplo-Eisenbahn zu ihnen gefahren kommt.
Von Kindern, die in einem aufwändig dekorierten Designerzimmer
schlafen. Von kichernden Kindern im Urlaub am Strand.
Puh.
Meine Kinder sind die bezauberndsten Wesen überhaupt. Ich lieb
sie mehr als alles und würde sie für nichts auf der Welt
hergeben.
Und ja, ich genieße sie: Schlaftrunken kuschelnd an meinem
Hals, glücklich im Wald, miteinander Geheimnisse ausheckend.
Aber nein, ich genieße sie bei Weitem nicht immer. Denn es ist anstrengend und ja, wie hart Elternschaft dich an deine Grenzen bringen kann, wie krass 24/7 Fremdbestimmung sein kann und wie unwägbar Familienleben ist, das hat mir vorher niemand gesagt!
Ich genieße es nicht, permanent Essen zuzubereiten (die
Spülmaschine läuft mindestens 3 mal täglich) und serviere es
nicht auf der elektrischen Duplo-Eisenbahn.
Meine Kinder schlafen nicht im perfekt aufgeräumten
Designerzimmer, sondern in Ikea-Betten von eBay Kleinanzeigen.
4 kleine Menschen in den Schlaf zu begleiten, ist
Höchstleistung.
Und kichernde Kinder im Urlaub am Strand? Haben wir auch
manchmal. Bis eins der Kinder einen Zusammenbruch hat, das
nächste weint und die beiden Kleinsten lebensgefährlichen Unfug
machen.
Ich liebe meine Kinder. Aber nein. Ich genieße sie nicht immer, die Mutterschaft.
Und das ist okay. Normal.
My biggest Hope
is that one day
my Kids look back on their childhood
and know that their mom loved them and did her best.
That she was gracious with herself.
And that because of that, they can be gracious with
themselves.
Because they are good enough.
Always.


Früher dachte ich, der Hoffnung würde immer ein „weil“ vorangehen. Und manchmal ist das wohl so. Und wir hoffen, WEIL es einen guten Grund gibt.
Aber in den letzten Jahren habe ich verstanden, dass die Hoffnung nicht nur mit dem „weil“ verbandelt sein kann, sondern auch mit dem „obwohl“. Dass ich hoffen kann, OBWOHL ich mich nicht der Illusion heiler Beständigkeit hingebe.
Mehr noch: Manchmal ist sie trotzig, die Hoffnung. Und ein TROTZDEM eilt ihr voraus.
Und schließlich wohnt Hoffnung für mich im UND. Im Gleichzeitigen.
WEIL, OBWOHL, TROTZDEM, UND: alle vier sind Konjunktionen. Verbindungswörter.
Hoffnung ist Verbindung.
Ein Text aus meinem Buch „Hoffnung, die leuchtet“ - mit Bezug zu einem anderen meiner Bücher, das sich ganz und gar dem Thema „und gleichzeitig…“ widmet.
„ (…) Und ja: es scheint zunächst verlockend, eindeutig beurteilen zu können, was Richtig und Falsch ist, was Sonne und Regen, was „die“ und „wir“. Unser menschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Denksystemen, nach einfachen Antworten, ist groß.
Doch langfristig und allgemeingültig tragfähig sind diese Antworten meist nicht.
Es ist eine einzige Geschichte von bröckelnder Eindeutigkeit, dieses Leben.
Eine Geschichte von unterschiedlichen Perspektiven, von Komplexität und Mehrdeutigkeit.
Eine Geschichte von Gleichzeitigkeit.
Eine Geschichte davon, dass es allermeistens mehr gibt als ein „entweder – oder“; „ganz oder gar nicht“.
Dass es allermeistens mehr gibt als nur Sonnenschein oder Regen. Und dass dort, wo sie sich treffen; die vermeintlichen Gegensätze; dort, in der Verbindung, der Regenbogen wohnt: das „und gleichzeitig“. Zufall, dass Regenbögen auch Zuversichtssymbol sind? Zufall, dass Regenbögen für mich persönlich so viel bedeuten? Ich denke nicht.
Diese beiden Worte, das „und“ ebenso sehr wie das „gleichzeitig“, haben meine vergangenen Jahre so sehr geprägt wie wohl keine anderen. Und haben mich so sehr geprägt wie wohl keine anderen.
Insbesondere in meiner Elternschaft, ganz besonders in meiner pflegenden Elternschaft als Mutter eines behinderten Kindes, musste die Eindeutigkeit an vielen Stellen der Gleichzeitigkeit Platz machen. Viel mehr, als ich es je für möglich gehalten hatte.
(…)
Und mit all diesen Gleichzeitigkeiten hielt auch das „und gleichzeitig“ Einzug: musste es. Denn es verhinderte das Aufeinanderkrachen und damit verbundenen Zerbruch und ermöglichte eine Integration beider Pole.
Liebe und gleichzeitig Erschöpfung. Kein entweder - oder.
Das hat mein Denken und meine Wahrnehmung der Welt ganz grundlegend verändert.
Mich weit und weich gemacht. Dafür, dass es oft anders kommt als gedacht. Dafür, dass Leben letztlich oft in der Gleichzeitigkeit stattfindet. Und es oft keine einfachen Antworten gibt.
2021 veröffentlichte ich mit Farbflausen schließlich einen Text zur Ambiguitätstoleranz, indem ich sie als das „sowohl als auch des Lebens“ – letztlich „und gleichzeitig“ - beschrieb. (…)
Es war mein erster Text zu diesem Thema
Selten hatte ich bis dahin zu einem Beitrag so viel Feedback bekommen – von so vielen Menschen, die ebenso empfanden - und seitdem waren das „und gleichzeitig“ und ich auch nach außen hin untrennbar miteinander verbunden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Texte und Illustrationen es waren, die ich dazu schrieb und malte – sehr viele.
(…)
Menschen begannen, mich auf Social Media zur Gleichzeitigkeit zu verlinken, ich bekam Anfragen für Vorträge zum Thema „und gleichzeitig“ und irgendwie – ja, irgendwie kommte das so, wie eins meiner Kinder zu sagen pflegt. Die Dinge verselbstständigten sich.
Es verwundert vielleicht gar nicht mehr, dass ich auf meinem linken Unterarm ein Tattoo habe, das „und gleichzeitig…“ als Kreis zeigt.
Nein, das verwundert wirklich nicht mehr.
Ebenso wenig verwundert wohl, dass ich nun hier im Zug sitze und an einem ganzen Buch schreibe, das eine Liebeserklärung an diese beiden Worte ist.
„Braucht es das denn“, könnte man vielleicht fragen, „wo du doch schon so viel dazu veröffentlicht hast?“
Und ja: Das braucht es. Oh, wie es das braucht.
Denn in „und gleichzeitig“ steckt so viel mehr, als auch nur ansatzweise in einem kurzen Text darstellbar ist. Damit wir in der Tiefe verstehen können, wie viel Schatz, Schlüssel und Schönheit in diesen beiden Worten liegt; auf welchen Ebenen sie funktionieren und welche Wirkmechanismen sie entfalten können – und was dazu nötig ist –, braucht es Zeit und Raum und Differenzierung: braucht es ein Buch. Dieses Buch.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Beschäftigung mit – und das Einüben von – „und gleichzeitig“ ein unglaublich wichtiger und letztlich unerlässlicher Prozess ist, wenn wir als Einzelne und auch als Gesellschaft gut miteinander leben möchten.
Denn „und gleichzeitig“ ist zentraler Schlüsselfaktor, um mit der Gleichzeitigkeit und Komplexität des Lebens umgehen zu können.
Das gilt sowohl für den Umgang mit nicht-selbstgewählter Gleichzeitigkeit, also für den Umgang mit den Dingen, denen Gleichzeitigkeit unumgänglich innewohnt und für die wir das „und gleichzeitig“ benötigen –
als auch für „und gleichzeitig“ als eine aktive Suche nach selbstgewählter oder selbstgesuchter Gleichzeitigkeit, bei der wir „und gleichzeitig“ nutzen können, um andere Perspektiven, Ressourcen oder Kompetenzen zu erschließen.
(…)
[Es] ist eine so, so große Aufgabe, in einer Welt zu leben, die derart viel Gleichzeitigkeit mit sich bringt."

Eine Leseprobe aus meinem Buch „und gleichzeitig… Eine Liebeserklärung an zwei Worte, die das ganze Leben umspannen.“ Du findest es bei mir im Shop.

Vor ein paar Wochen standen wir an der Supermarktkasse, unser mittleres Kind und ich. Er fuhr mit der Hand über die Rollen, die angebracht waren, um bereits gescannte Waren weiter zu befördern, damit sie eingepackt werden können. Immer und immer wieder rollte er mit der Hand darüber, schloss die Augen und genoss, wie es sich anfühlte. Beobachtet von der Kassiererin, die über sein Gerolle die Stirn runzelte und harte Mundwinkel bekam.
„Hast du kein Spielzeug zuhause, dass du jetzt hier mit den Rollen spielen musst?“, fuhr sie ihn plötzlich scharf an. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, lächelte mein Kind die Kassiererin an und antwortete freundlich „Ja, doch, zuhause hab ich viel schönes Spielzeug. Hast du denn keins? Wenn du möchtest, komm doch vorbei und wir können zusammen spielen. Ich wohne in der Hausnummer 6!“
Ihr entglitten die Gesichtszüge.
Pause.
Zögern.
„Ja, das wäre schön“, sagte sie und lächelte.
Weihnachten. Das trotzig Hoffende. Das naiv Sanftmütige. Das waghalsig Glaubende: Dass es immer Sinn ergibt, daran zu festzuhalten, dass die Welt friedlicher werden kann. Und dass das, was ich dazu beitragen kann, nie zu klein ist, um einen Unterschied zu machen.
